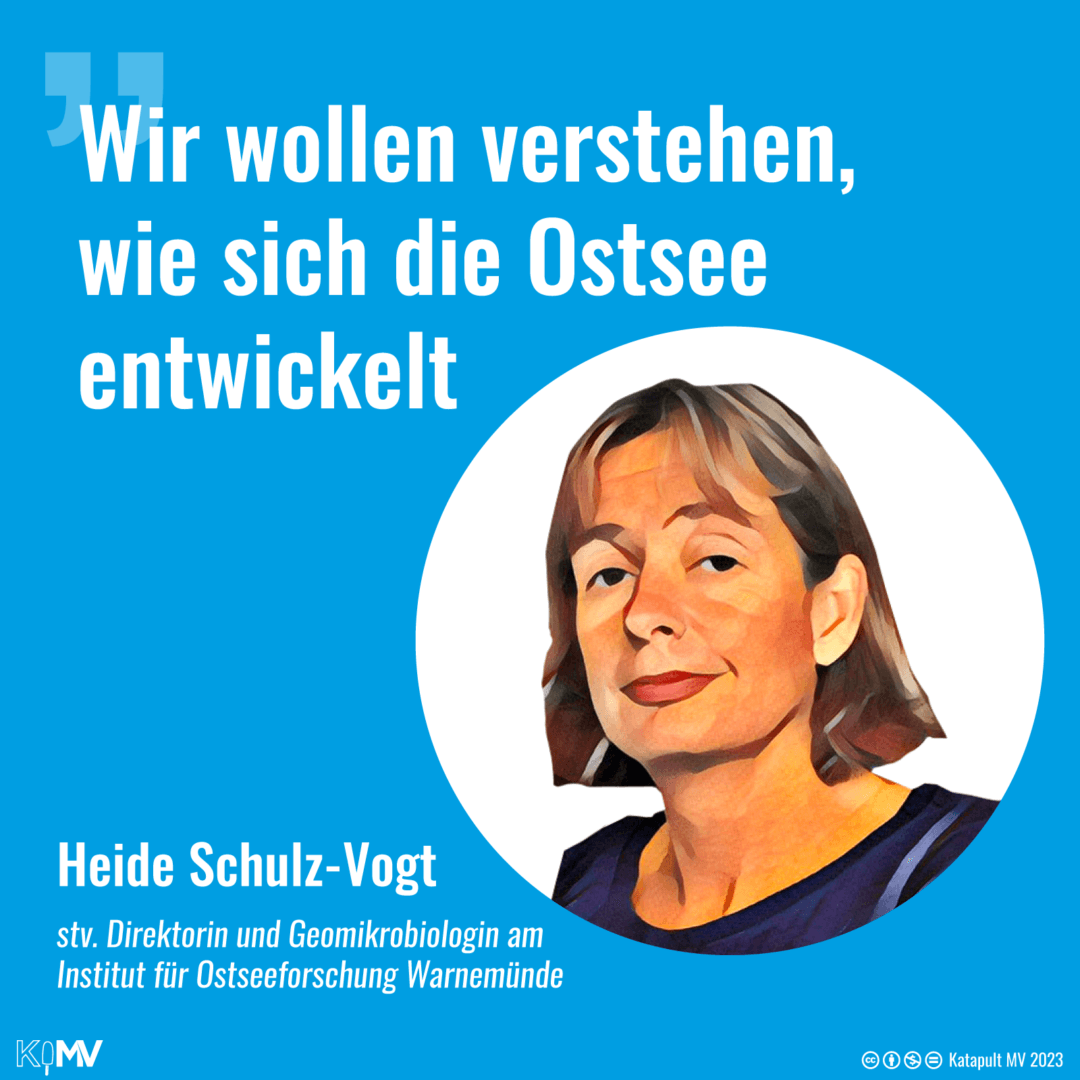Vor der Küste Chiles untersuchten Wissenschaftler:innen sowohl die zivilisationsbedingte Verschmutzung des Ozeans als auch die Auswirkungen von sauerstoffarmen und sauerstofffreien Regionen im Wasser. Diese sogenannten Anoxien sind auch in der Ostsee typisch, wo sie verstärkt durch menschlichen Einfluss entstehen.
KMV: Frau Schulz-Vogt, Sie sind Geomikrobiologin und beschäftigen sich unter anderem mit biogeochemischen Stoffkreisläufen im Wasser. Was heißt das genau?
Heide Schulz-Vogt: Die meisten Menschen kennen Bakterien nur als Krankheitserreger, dabei sind die allermeisten Bakterien harmlos. Sie sind aber essenziell beteiligt an allen Stoffkreisläufen im Meer und an Land. Bakterien haben unsere Welt geschaffen. Als Geomikrobiologin betrachte ich das Zusammenspiel von Geologie und Mikrobiologie. Das ist ein weites Feld. Biogeochemisch heißt im Grunde, dass sich durch die Aktivität von Bakterien die Konzentration bestimmter Stoffe erhöht oder abnimmt und damit Prozesse ausgelöst werden, die nicht mehr biologisch sind. In unserem Expeditionsabschnitt vor der chilenischen Küste betrachten wir Algen, deren Biomasse viel Sauerstoff verbraucht. Dadurch entstehen anoxische Gebiete im Wasser. Wir kennen das Prinzip vor allem aus Seen, die unter bestimmten Voraussetzungen umkippen können.
Ihre Zielgebiete im Pazifik sind das küstennahe Schelfgebiet vor der Stadt Concepción, in dem windbedingter Auftrieb regelmäßig nährstoffreiches, aber sauerstoffarmes Tiefenwasser an die Oberfläche transportiert, sowie der von menschlichem Einfluss weitgehend unberührte anoxische Fjord Golfo Almirante Montt. Warum führt Ihre Expeditionsreise gerade dorthin?
Wir wollen den Übergang von anaeroben, also sauerstoffarmen, zu aeroben, sauerstoffhaltigen Bereichen im Wasser untersuchen. In der Ostsee ist das ein wichtiges Thema, darum interessieren wir uns auch für andere Gebiete, wo ähnliche Bedingungen herrschen. Wir wollen schauen, was die Prinzipien sind, die immer mit Anoxien im Wasser auftreten, auch wenn sie aus unterschiedlichen Grundsituationen hervorgehen.
Im Küstenbereich vor Concepción wird durch Algenwachstum sehr viel Biomasse aufgebaut, die wiederum von Mikroorganismen zersetzt wird. Dieser Abbauprozess verbraucht Sauerstoff im Wasser, bis er irgendwann aufgebraucht ist. Gleichzeitig gehört die chilenische Küste zu den fischreichsten Gebieten der Welt. Die Region interessiert uns, weil sie ganz andere Voraussetzungen bietet als die Ostsee, die aber ebenfalls zu anaeroben Bereichen führen, wie wir sie auch vor den Küsten unseres Binnenmeeres haben.
Das zweite Gebiet, das wir untersuchen, ist ein Fjord in Patagonien, der so eingeschlossen ist, dass sein Bodenwasser auf natürliche Weise anoxisch ist. Es findet aufgrund der geografischen Gegebenheiten kaum Wasseraustausch mit dem Pazifik statt. Die Umgebung des Fjords ist jedoch nicht von starker Landwirtschaft und dichter Besiedlung geprägt. Hier können wir untersuchen, welche Auswirkungen Anoxien in einer naturbelassenen Umgebung haben.
Unser Lieblingsvergleichsmeer ist allerdings das Schwarze Meer, aber da kommen wir jetzt nicht mehr rein. Der Bosporus ist noch schmaler als das Kattegat. Das führt dazu, dass das Schwarze Meer am Boden permanent anoxisch ist. Im Gegensatz dazu kommt es in der Ostsee alle fünf bis zehn Jahre zu einem größeren Wassereintrag aus der Nordsee. Dieses frische, aerobe Wasser strömt über den Boden der Ostsee und belüftet sie. Insofern ist das Schwarze Meer anders, aber auch stabiler. Das Ökosystem ist darauf eingestellt und wird nicht wie in der Ostsee dauernd durcheinandergebracht.
Welche Erkenntnisse erhoffen Sie sich von der Expedition?
Wir betreiben Grundlagenforschung. Das ist wichtig, wenn man anwendungsbezogen werden will. Uns geht es darum, die generellen Mechanismen und Prinzipien an den Grenzen zwischen oxisch und anoxisch besser zu verstehen. Es geht auch immer darum, zu erkennen, was ein Zufall oder eine Ausnahme in einer speziellen Situation sein kann und was generell immer gleich sein wird. Wenn man verschiedene Ökosysteme betrachtet, die unterschiedlich stark anoxisch sind, dann kann man auch vorhersehen, was passieren wird, wenn sich die Anoxien in der Ostsee stärker ausprägen. So können wir die Richtung abschätzen, in die sich das Gewässer entwickelt. Wir wollen in erster Linie immer besser verstehen. Für Prognosen sind dann die Modellierer zuständig, die ihre Modelle auf der Datenlage aufbauen, die wir mit unseren Erkenntnissen liefern.
Dieser Artikel erschien im März in Ausgabe 17 von KATAPULT MV.