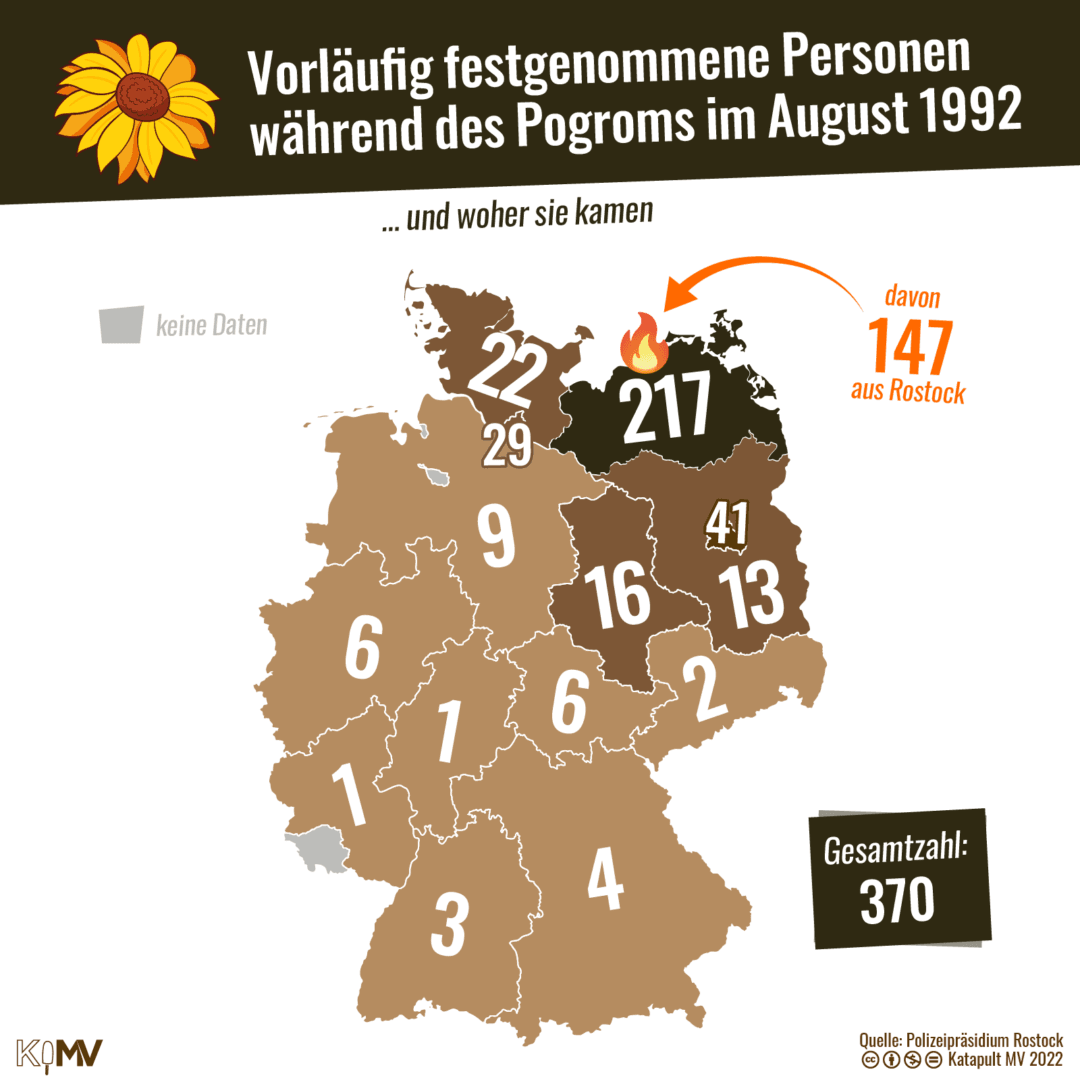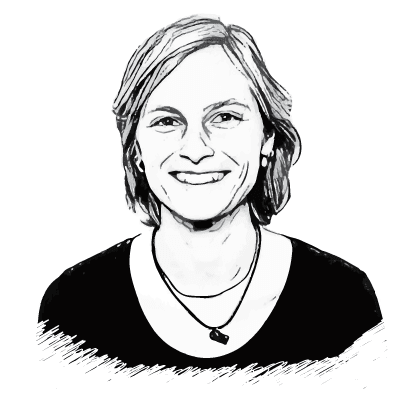Die Aufarbeitung der genauen Vorfälle von Rostock-Lichtenhagen ist nicht gänzlich abgeschlossen, wird sie wohl auch niemals sein. Protokolle fehlen, Zuständigkeiten können nicht mehr nachgewiesen werden und weder alle Täter:innen noch die Opfer wurden vor Gericht umfassend angehört.
Von 408 eingeleiteten Ermittlungsverfahren wurden in den Jahren nach dem Pogrom etwa 250 tatsächlich als Strafverfahren eröffnet. Die meisten allerdings wieder eingestellt. Verurteilt wurden elf Täter wegen Landfriedensbruchs und Brandstiftung. Alle erhielten Jugendhaftstrafen. Sieben von ihnen auf Bewährung, vier mussten eine Gefängnisstrafe absitzen. Ansonsten waren es nach Angaben des Landesinnenministeriums vor allem Delikte wie Raub, Diebstahl und Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. Der Großteil der an den Ausschreitungen Beteiligten bleibt bis heute anonym und straffrei.
In einem Prozess vor dem Schweriner Landgericht ging es 2002 – zehn Jahre nach dem Pogrom – erstmals auch um versuchten Mord. Drei Personen wurden damals nach Jugendstrafrecht zu Gefängnisstrafen zwischen 12 und 18 Monaten auf Bewährung verurteilt. Zum Tatzeitpunkt waren sie 17, 18 und 19 Jahre alt und bereits wegen Körperverletzung vorbestraft.Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die drei Männer das Sonnenblumenhaus in Brand gesteckt und dabei den Tod der Menschen im Haus bewusst in Kauf genommen hatten. Strafmildernd wirkte sich aus, dass die Taten so lange zurücklagen und einige bereits verjährt waren.
Ein Großteil bleibt straffrei
Die wenigen und vergleichsweise milden Urteile sorgten für Kritik. Beobachter:innen und Beteiligte, wie Jost von Glasenapp, damals Anwalt einer der Kläger:innen, werfen dem Gericht zudem Verschleppung vor. Denn die Anklage lag bereits seit 1995 beim Landgericht. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk spricht der Anwalt von „einer fortgesetzten Panne der Pannen“. Besonders problematisch seien in allen Ermittlungsverfahren fehlende Protokolle und unzureichend gesicherte Beweismittel, heißt es von der Rostocker Staatsanwaltschaft. Diese teilt auf Nachfrage dazu mit, dass für die wenigen jemals vorhandenen Beweisstücke die Aufbewahrungspflichten bereits abgelaufen seien.
Entlassen, zurückgetreten, wegbefördert
Auch wegen des Polizeieinsatzes wurde ermittelt: Gegen Polizeibeamte und Politiker gab es 35 Anzeigen. Die Ermittlungen gegen Rostocks damaligen Polizeidirektor Siegfried Kordus wurden 1994 eingestellt. Er wurde wenige Tage später zum Direktor des Landeskriminalamtes befördert. Gegen den Einsatzleiter, Polizeioberrat Jürgen Deckert, lief ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung durch Unterlassen, das im Jahr 2000 ebenfalls eingestellt wurde. Nach den Vorfällen wurde er als Dozent an die Polizeifachhochschule nach Güstrow versetzt.
Für die politischen Akteure hatte das Pogrom kaum Folgen: Innenminister Lothar Kupfer (CDU) wies jede Verantwortung von sich, trat jedoch im Februar 1993 zurück.Ein Untersuchungsausschuss der Rostocker Bürgerschaft stellte zudem fest, dass der damalige Oberbürgermeister Klaus Kilimann (SPD) „seiner politischen und moralischen Verantwortung nicht gerecht geworden“ sei. Daraufhin trat auch er 1993 von seinem Amt zurück.
Auf die Karriere der anderen Akteure wirkte sich Lichtenhagen nicht weiter aus: Der damalige Polizeiinspektor Dieter Hempel trat zwar 1999 als Polizeiinspektor zurück, jedoch nicht im Zuge der Lichtenhagen-Aufarbeitung. Sondern aufgrund von Mobbingvorwürfen gegen seinen Arbeitgeber. Bundesinnenminister Rudolf Seiters (CDU) bleibt nach 1992 in der Bundespolitik: Von 1994 bis 1998 ist er stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, anschließend bis 2002 Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Der damalige Innensenator Peter Magdanz (SPD) ist heute Citymanager von Rostock. Ministerpräsident Berndt Seite (CDU) wurde ein zweites Mal Ministerpräsident, blieb bis 2002 in der CDU-Landtagsfraktion. Mittlerweile hat er sein zwanzigstes Buch veröffentlicht –kein einziges davon zum Thema Rostock-Lichtenhagen.Auf eine Interviewanfrage von KATAPULT MV hat er nicht reagiert.
Justiz und Polizei im Fokus
Michael Ebert ist heute Direktor der Landesbereitschaftspolizei und aktuell OB-Kandidat von CDU und FDP für Rostock. Er war damals vor Ort und wurde schon anlässlich vergangener Jahrestage zum Verhalten der Polizei interviewt. Ebert war 1992 Truppführer einer Ausbildungseinheit. Keine:r der Beamt:innen habe zu Beginn des Einsatzes genau gewusst, was passieren würde, erzählt er. Man habe lediglich die Anweisungen befolgt. Viele seien vom Hass der Masse schockiert gewesen. Auch insgesamt 204 Einsatzkräfte wurden laut dem Polizeipräsidium Rostock in den vier Tagen des Pogroms verletzt. Man sei überfordert gewesen, es habe zu wenig Beamt:innen gegeben, weshalb auch das Ausbildungspersonal herangezogen werden musste. Ebert bilanziert eine „organisierte Unverantwortlichkeit“.
Das Innenministerium MV verweist auf Nachfrage darauf, dass „1992 – drei Jahre nach dem Mauerfall – die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern noch stark damit befasst war, sich unter Führung von Kollegen aus den alten Bundesländern umzustrukturieren und neu zu organisieren“.Gesprächsprotokolle, etwa zum Krisenstab am 24. August 1992 mit Bundesinnenminister Rudolf Seiters (CDU), Ministerpräsident Berndt Seite (CDU), Landesinnenminister Kupfer (CDU) und Polizeichef Kordus in der Rostocker Polizeidirektion, mit deren Hilfe nachträglich Entscheidungen oder Versäumnisse hätten geklärt werden können, wurden offenbar nicht geführt.
Auch der Schweriner Landtag setzte einen Untersuchungsausschuss ein, um die genauen Abläufe und Fehler aufzuarbeiten. Dabei untersuchte man das Vorgehen der Polizei vorwiegend unter dem Gesichtspunkt innenpolitischer Versäumnisse. Zusammenfassend heißt es dazu im Bericht, dass weder das Innenministerium noch die Hansestadt Rostock deutlich die Aufgaben und somit auch Verantwortlichkeiten von Ausländerbehörde und Aufnahmestelle unterschieden hätten. Außerdem wurde im Zuge von Zeug:innenvernehmungen festgestellt, dass „die Hansestadt Rostock und die Polizei die ihr gesetzlich zugewiesenen Zuständigkeiten nicht erkannt und nicht wahrgenommen“ hätten. Weitere Konsequenzen wurden aus den Erkenntnissen nicht gezogen.
2002 – im Jahr der letzten Urteile in den Lichtenhagen-Prozessen – sprach der damalige Oberbürgermeister Arno Pöker (SPD) eine offizielle Entschuldigung der Stadt aus. Entschädigungen für die Opfer gab es bis heute nicht.
Mit dem Ende der Verfahren gilt die juristische Aufarbeitung offiziell als abgeschlossen.
Dieser Artikel erschien in Ausgabe 11 von KATAPULT MV.
Transparenzhinweis: In der ersten Version des Artikels haben wir Peter Magdanz als Innenminister genannt, richtig ist aber Innensenator der Stadt Rostock. Landesinnenminister war zu dieser Zeit, wie ein paar Zeilen später geschrieben, Lothar Kupfer (CDU).
Quellen
- Bayern 2 (Hg.): Die rassistischen Angriffe von Rostock-Lichtenhagen 1992, auf: ardaudiothek.de (24.6.2022).↩
- Zur politischen Einstellung kann das Innenministerium nach eigener Aussage keine gesicherten Angaben machen.↩
- Die Zeit (Hg.): Mordversuch, auf: zeit.de (20.6.2002).↩
- Deutschlandfunk (Hg.): Bewährungsstrafen im Lichtenhagen-Prozess, auf: deutschlandfunk.de (18.6.2002).↩
- Soziale Bildung (Hg.): Konsequenzen aus Lichtenhagen, auf: lichtenhagen-1992.de.↩
- Die Zeit (Hg.): Abgetan, auf: zeit.de (19.11.1993).↩
- Hamburger Abendblatt (Hg.): Ex-Polizeichef beschuldigt Ministerium, auf: abendblatt.de (4.10.1999).↩
- Lingen, Markus: Rudolf Seiters, auf: kas.de.↩
- citykreis-rostock.de.↩
- Regierung MV (Hg.): Dr. Berndt Seite, auf: regierung-mv.de.↩
- Zeit Online (Hg.): Ex-Ministerpräsident Seite stellt neues Buch vor, auf: zeit.de (27.7.2022). ↩
- Stand: 15.8.2022.↩
- Mathwig, Inga; Rausch, Hans J.: Die Narbe – Der Anschlag in Rostock-Lichtenhagen, auf: ndr.de.↩
- Hasselmann, Silke: Protokoll einer Eskalation, auf: deutschlandfunk.de (22.8.2017).↩
- Landtag MV (Hg.): Beschlussempfehlung und Zwischenbericht des 2. Untersuchungsausschusses nach Artikel 34 der vorläufigen Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern und dem vorläufigen Untersuchungsausschußgesetz, S. 19 (16.6.1993).↩
- Ebd., S. 25.↩