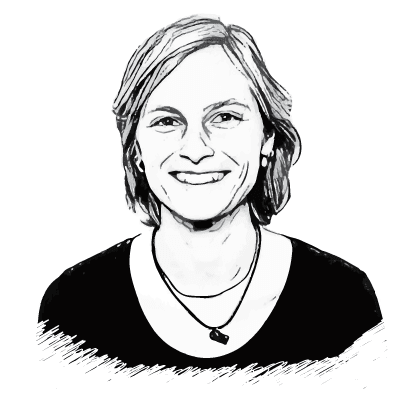Laut Frank Ney-Matiba, Chefarzt der Abteilung für Allgemein- und Alterspsychiatrie an der Stralsunder Uhlenhausklinik, kennt wohl fast jede:r eine Person im näheren Umfeld mit einer psychischen Erkrankung: „Diese sind ausgesprochen häufig.“ Bei den meisten seien es Angststörungen. Etwa ein Viertel der Bevölkerung leidet daran. Immer häufiger finden sich aber auch schwerwiegendere Diagnosen, wie Depression, in den Statistiken. Neben ihr und der Persönlichkeitsstörung zählt Schizophrenie zu den schwersten psychischen Erkrankungen. Die Krankheit bedeutet nicht, wie oft verwechselt, eine gespaltene Persönlichkeit, sondern eine Netzwerkstörung des Gehirns, wodurch Halluzinationen ausgelöst werden. Das kann in akuten Phasen zu Angst- und Wahnvorstellungen führen, erklärt Ney-Matiba. Nur sprächen Betroffene so gut wie gar nicht offen darüber, „meist aus Angst, als ‚verrückt‘ zu gelten“.
Lange gab es so gut wie keine adäquate medizinische Versorgung für psychisch erkrankte Menschen in Deutschland. Bis in die späten 1970er-Jahre wurden sie in Großanstalten untergebracht und damit gleichzeitig von der Gesellschaft isoliert, erzählt Karsten Giertz vom Landesverband Sozialpsychiatrie. Dabei hat die gesellschaftliche Integration einen großen Einfluss auf Erkrankte. Die Isolation in Hospitälern habe deshalb oft zu einer Verschlimmerung der Symptome geführt. Heute kümmert sich die Sozialpsychiatrie um einen besseren Umgang für jede und jeden einzelnen. Das große Ziel: Erkrankte wieder in die Gesellschaft einzubinden. Aber genau darin besteht die Herausforderung.
Eine Krankheit der Jungen
Rund 65 Prozent der an Schizophrenie erstmalig Erkrankten sind jünger als 30 Jahre. Zwar ist die Erkrankung genetisch bedingt, Auslöser können aber emotionale Umbruchphasen sein, wie Abschlussprüfungen, Trennungen oder Todesfälle, vor allem, wenn sie in der ohnehin schon schwierigen Phase der Pubertät auftreten, so Ney-Matiba. Wenn in dieser Zeit unvorhersehbare Stresssituationen zunehmen, steigt für Menschen mit einer erhöhten Anfälligkeit die Wahrscheinlichkeit, eine Psychose, also eine akute Phase, zu durchlaufen.
Bei vielen Betroffenen wird Schizophrenie zwischen dem 16. und dem 25. Lebensjahr diagnostiziert. Und besonders in diesem Alter ist sie für Außenstehende meist schwer zu erkennen, weiß der Chefarzt, „weil es für die Jugendlichen generell eine Zeit vieler Änderungen und hoher psychosozialer Belastungen ist. Es ist nicht unbedingt ungewöhnlich, dass sie etwa gereizt wirken oder sich stärker zurückziehen.“ Familien und Freunde würden das oft der Pubertät zuschreiben, manchmal könne es sich dabei aber eben auch um erste, unspezifische Symptome handeln.
Hinzu kommt, dass es kein eindeutiges Krankheitsbild gibt. Beeinträchtigt werden Denken, Gefühlswelt und Realitätsempfinden, aber wie genau, äußert sich ganz individuell. Bei Hannah Ree aus München waren es zum Beispiel visuelle Störungen und Wahnvorstellungen: „Ich habe keine Stimmen gehört, sondern Personen in anderen Menschen erkannt, wenn sie ähnliche Merkmale hatten. Zum Beispiel eine Freundin, mit der ich mich zerstritten hatte.“ Auch in Fernsehsendungen bezog sie vieles auf sich, zog Schlüsse aus Fakten, mit denen sie gar nichts zu tun hatte, fühlte sich dadurch aber beobachtet. Besonders ausgeprägt sei die Vergiftungsangst gewesen, erinnert sie sich. Damals hatte sie sich kurz zuvor von ihrem Freund getrennt und dachte, er habe ihre Lebensmittel vergiftet. Der emotionale Stress und der Prüfungsdruck vor dem anstehenden Abitur waren vermutlich der Auslöser, weiß sie jetzt. Aber auch in ihrer Familie habe es Vorerkrankungen gegeben. Heute ist Ree 27 Jahre alt. Zehn Jahre ist ihre Psychose her. Als es ihr immer schlechter ging, suchte sie Hilfe bei ihrem Hausarzt. Er erkannte eine Reihe von Symptomen und verwies sie in psychologische Behandlung. Die offene Kinder- und Jugendpsychiatrie im Raum München war für sie „ein Rückzugsort“, der ihr guttat. Mit ihr waren 15 bis 20 Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren dort untergebracht – mit verschiedenen psychischen Erkrankungen.
„Ich hatte Glück, dass es in meinem Fall bei einer einmaligen Phase geblieben ist“, blickt die junge Frau zurück. Tritt nach etwa vier Jahren keine weitere schizophrene Psychose auf, gilt eine Wiederholung als relativ ausgeschlossen. Ree konnte ihr Abitur nachholen, eine Ausbildung abschließen und ein Studium beginnen. „Ich achte in Stressphasen immer noch darauf, mich nicht zu überfordern“, verrät sie. Aber sie lebe ohne Angst vor einem neuen Ausbruch. „Andere Erkrankte haben mehr zu kämpfen.“
Zwei Drittel brauchen Langzeittherapie
Bei etwa 20 bis 25 Prozent der Betroffenen bleibt es nach erfolgreicher Behandlung bei einer einzigen psychotischen Episode, sie gelten als vollständig genesen. Bei den übrigen Patient:innen kann es zu Rückfällen kommen. Bei bis zu einem Drittel der Erkrankten ist die Psychose chronisch und tritt in Schüben auf, bei einem weiteren Drittel sind die Beschwerden dauerhaft. Je früher sie behandelt wird, desto besser stehen die Chancen auf eine positive Beeinflussung des Krankheitsverlaufs oder – im besten Fall – auf Heilung, so Chefarzt Ney-Matiba.
Behandlung heißt in diesen Fällen: Psychopharmaka und Psychotherapie. Hannah Ree nahm nach ihrer Diagnose vier Jahre lang Medikamente. Schon nach zwei Jahren fühlte sie sich besser, wollte sie eigentlich absetzen. Ein zu frühes Beenden der Medikation aber könne einen Rückfall auslösen. Auch das sei jedoch ganz individuell zu betrachten. Bislang bringe die Einnahme von antipsychotisch wirksamen Medikamenten noch die größte Aussicht auf Erfolg, sagt Ney-Matiba. Allerdings können sie unangenehme Nebenwirkungen haben, die Einnahme mit Ängsten verbunden sein.
Vereinzelt gebe es Versorgungsangebote, die ganz auf Medikamente verzichten und wo Erkrankte ihre psychotische Phase ausleben könnten. Auch das hänge von der individuellen Ausprägung der Schizophrenie und dem Wunsch der Erkrankten ab. Was er nicht empfiehlt, ist eine Selbstmedikation etwa mit Drogen – ein weit verbreitetes Problem in diesem Umfeld.
Cannabis: eher schädlich als nützlich?
50 bis 80 Prozent der Betroffenen nehmen Suchtmittel, allen voran Alkohol und Cannabis. Das würde bei Wahnvorstellungen viele beruhigen, erklärt Karsten Giertz vom Landesverband für Sozialpsychiatrie. Allerdings fördern diese Substanzen auch die Erkrankung, führen zu stärker ausgeprägten Symptomen. Auch Chefarzt Ney-Matiba blickt mit Sorge auf die kürzlich erfolgte Teillegalisierung von Cannabis. „Regelmäßiges Kiffen kann, wie der Konsum anderer psychoaktiver Substanzen wie Amphetamine, das Risiko eines Ausbruchs bei Menschen mit einer entsprechenden Veranlagung erhöhen. Bei diagnostizierter Schizophrenie beeinflusst der regelmäßige Konsum den Krankheitsverlauf negativ.“
Vorpommern vergleichsweise gut aufgestellt
Der Vorteil des ländlichen Raums seien geringere Stressfaktoren, wie Verkehrs- und Einwohner:innendichte, erklärt Ney-Matiba. Das stressreiche Leben in Großstädten könne dazu führen, dass sich der Krankheitszustand verschlechtere. Auch wenn in Großstädten wie Berlin statistisch gesehen die Versorgungslage besser ist. MV ist im Vergleich zu anderen Bundesländern jedoch zumindest im stadtnahen Bereich relativ gut aufgestellt. Grundsätzlich gibt es in allen Landkreisen sogenannte Psychiatriekoordinator:innen. Sie versuchen, Arbeitsgemeinschaften mit fachübergreifenden Expert:innen zu etablieren und die Sichtbarkeit der Anlaufstellen zu verbessern.
Besonders die Regionen Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen ragen heraus. In Stralsund gibt es eine Spezialisierung auf psychiatrische Erkrankungen. Für Kinder und Jugendliche existieren vollstationäre und tagesklinische Angebote und neben dem Helios-Klinikum bieten auch die Einrichtungen der Uhlenhausklinik in Stralsund, Bartmannshagen und Grimmen verschiedene Angebote. Ebenso das Krankenhaus Bethanien der Johanna-Odebrecht-Stiftung und die Universitätsmedizin in Greifswald.
Während sich in Vorpommern die Versorgungslage stetig verbessert, gebe es in Mecklenburg noch so einige weiße Flecken, sagt Giertz. Und grundsätzlich seien außerhalb der Städte die zum Teil sehr langen Anfahrtswege und fehlenden Informationen über bestehende Hilfsangebote ein Problem. Auch sind aus Sicht des Landesverbands eine flächendeckende regionale Vernetzung und verbindliche Zusammenarbeit zwischen den Expert:innen nötig. Niedrigschwellige Angebote vor allem im Bereich der Prävention, Früherkennung und -intervention müssten ausgebaut werden. Besonders darauf will sich der Verband konzentrieren.
Denn mit der Diagnose Schizophrenie wird man gesellschaftlich isoliert. Oft wenden sich selbst Freunde und Verwandte ab. Aber auch aus dem Arbeitsleben werden Betroffene oft ausgeschlossen. Haben sie bereits einen Beruf, fallen Erkrankte in psychotischen Phasen häufig mit Fehlzeiten auf. „Allerdings kommen die meisten gar nicht erst in ein Arbeitsverhältnis“, betont Giertz. Denn mit den meist frühen Diagnosen haben Erkrankte oftmals gerade erst die Schule beendet oder sind in einer Ausbildung. „Viele der Betroffenen stehen erst am Anfang ihres Lebens.“ So bricht bereits in jungen Jahren das soziale Gefüge weg. Die Vereinsamung geht meist mit Folgeproblemen einher: Diabetes, Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. „Neben den allgemeinen Belastungen durch die Krankheit kann das auch an den Psychopharmaka liegen, aber eben nicht nur“, so Giertz. Psychisch Erkrankte sterben zudem etwa 15 Jahre früher als die Durchschnittsbevölkerung.

Mit Schulprojekten gegen Vorurteile
Um ihnen bessere Chancen zu ermöglichen, braucht es mehr Engagement und Verständnis. So drängt der Verband seit Jahren auf eine Erweiterung der adoleszenzpsychiatrischen – also auf Kinder und Jugendliche ausgerichteten – Angebote im Land, besonders des betreuten Wohnens mit einer Alltagshilfe und Hilfe beim Berufseinstieg. Und das vor allem zusammen mit den Betroffenen, nicht über sie hinweg.
Ein großer Erfolg ist bisher das Projekt Ex-In des gleichnamigen Vereins. Er ist international tätig, seine MV-Zentrale befindet sich in Rostock. Ehemals Erkrankte werden bei Ex-In zu sogenannten Genesungsbegleiter:innen ausgebildet. Der Blick von ehemals Betroffenen soll helfen, die Strukturen und Therapiemöglichkeiten zu verbessern. Die Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin in Stralsund ist bereits Teil des Projekts: Seit dem vergangenen Jahr ist dort ein solcher Genesungsbegleiter tätig. „Durch die gelebten Erfahrungen und deren Bewältigung können sie Hoffnung spenden und Verständnis fördern“, sagt Thomas Hacker, psychologischer Psychotherapeut.
Aber nicht nur bei den Behandlungen gilt es nachzujustieren, sondern auch in der Bevölkerung. Das Thema müsse dort präsenter werden, fordert Giertz – und zwar mit Begegnungsräumen. So hat sein Bundesverband ein Schulprojekt namens Verrückt – na und?! entwickelt. Bei Klassenbesuchen erzählen eine Person mit Schizophrenie und eine Betreuungsperson über ihre Arbeit, verraten aber erst am Ende, wer der Erkrankte ist. Über 2.000 Schüler:innen und 600 Lehrkräfte an knapp 50 Schulen wurden in MV bereits erreicht. Genau so etwas baue Vorbehalte am besten ab, schildert Giertz seine Erfahrungen. Auch offene Begegnungsräume zwischen Menschen mit und ohne psychische Erkrankungen, „wo man einfach ins Gespräch kommen kann“, brauche es mehr.
Für ein Ende der Stigmatisierung
Für Betroffene ist das größte Problem das Stigma, sagt die ehemals erkrankte Hannah Ree. Deswegen würden viele auch über ihre Krankheit schweigen. Schon mehrfach sei es passiert, dass Bekannten gekündigt wurden oder sie ihre Wohnung verloren, wenn sie von ihrer Erkrankung erzählten. „Die Resonanz, die wir bisher erhielten, war leider oft geprägt von Unverständnis und Intoleranz.“
Psychotische Phasen, zum Beispiel mit Verfolgungswahn, können dazu führen, dass die Erkrankten sich in Angstzustände hineinsteigern und damit sich und potenziell auch andere gefährden. Aber das sei eher eine seltene Ausnahme als die Regel, betont Karsten Giertz. Doch leider würden solche Ausnahmefälle von Medien oft als abschreckende Beispiele präsentiert. „In Horrorfilmen ist am Ende immer der Schizophrene der Mörder.“ Bei Vorfällen mit Betroffenen werde in Polizeimeldungen und Artikelüberschriften die Erkrankung immer besonders hervorgehoben. Giertz beobachtet sogar eine Zunahme der Vorurteile: „Depressionen und psychiatrische Institutionen, wie etwa zum Psychiater zu gehen, sind weitgehend anerkannt“, erklärt er, aber Suchterkrankungen und Schizophrenie würden nach wie vor stark tabuisiert. Das zeigt auch eine aktuelle Studie. Schizophren zu sein wird noch immer als Schimpfwort genutzt, steht sogar mit „Gebrauch: häufig abwertend“ im Duden.
Daran will Hannah Ree etwas ändern, hat deswegen im vergangenen Jahr in Berlin eine Demonstration für die Rechte von Menschen, die an Schizophrenie erkrankt sind, organisiert. 60 Leute kamen. Für sie ein erster Erfolg. Aber man müsse die Betroffenen stärker selbst zu Wort kommen lassen. Nur so könne gezeigt werden, dass es nicht nur Negativbeispiele gibt. „Zum Beispiel entwickeln viele Menschen in ihrer Psychose eine enorme Kreativität“, erzählt sie. In Leipzig arbeite man an einer Ausstellung über Kunst von Betroffenen, wie sie es auch schon in der Schweiz oder Frankreich gegeben hat.
Das große Ziel von Ree, wie auch von Verbänden, Mediziner:innen und Betroffenen: dass Schizophrenie wie auch Depression gesellschaftlich anerkannt wird. „Schizophrenie ist eine der am stärksten beeinträchtigenden Erkrankungen. Daher ist es grundsätzlich hilfreich, wenn Ihnen möglichst viel Respekt, Verständnis und Unterstützung entgegengebracht wird“, schließt Ney-Matiba. Und die Möglichkeit, zu zeigen, dass die Betroffenen mehr sind als ihre Erkrankung.
Der Artikel erschien erstmals in unserer Maiausgabe.
Quellen
- Telefonat mit Frank Ney-Matiba am 4.4.2024.↩
- Müller-Lissner, Adelheid: Wie ein Gewicht auf den Schultern. Was sind die Gründe für eine Angsterkrankung?, auf: tagesspiegel.de (9.10.2023) / Stiftung Gesundheitswissen (Hg.): Was ist eine Angststörung?, auf: stiftung-gesundheitswissen.de.↩
- Falkai, P. u.a.: Schizophrenie als Netzwerkstörung, auf: thieme-connect.com (23.2.2018) / Taminga, Carol: Schizophrenie, auf: msdmanuals.com (April 2022).↩
- Karow, Anne u.a.: Psychosen, auf: psychenet.de (29.3.2024) / Neben Schizophrenie kann hinter einer Psychose auch eine Depression oder bipolare Störung, die sich durch abwechselnd manische und depressive Phasen kennzeichnet, stecken (Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen (Hg.): Bipolare Störung, auf: dgbs.de).↩
- Telefonat mit Hannah Ree am 8.4.2024.↩
- E-Mail von Frank Ney-Matiba vom 17.4.2024.↩
- Gaebel, Wolfgang; Wölwer, Wolfgang: Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 50: Schizophrenie, S. 7, auf: rki.de / Taminga 2022.↩
- E-Mail der Pressestelle des Landkreises Vorpommern-Rügen vom 4.4.2024.↩
- Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (Hg.): S3-Leitlinie Schizophrenie, Kurzfassung, S. 18, auf: register.awmf.org.↩
- Ex-In Mecklenburg-Vorpommern (Hg.): Was ist Ex-In? auf: ex-in-mv.de.↩
- E-Mail der Pressestelle des Helios-Hanseklinikums Stralsund vom 9.4.2024.↩
- irrsinnig-menschlich.de.↩
- E-Mail von Hannah Ree vom 24.2.2024.↩
- Schomerus, Gregor u.a.: Die Einstellung der deutschen Bevölkerung zu psychischen Störungen, auf: link.springer.com (28.2.2023).↩
- Duden (Hg.): schizophren, auf: duden.de.↩
- Steinbrich, Leonel: Gegen das Stigma, auf: taz.de (25.5.2023).↩
- facebook.com/KunstgalerieSchizophrenieBerlin.↩