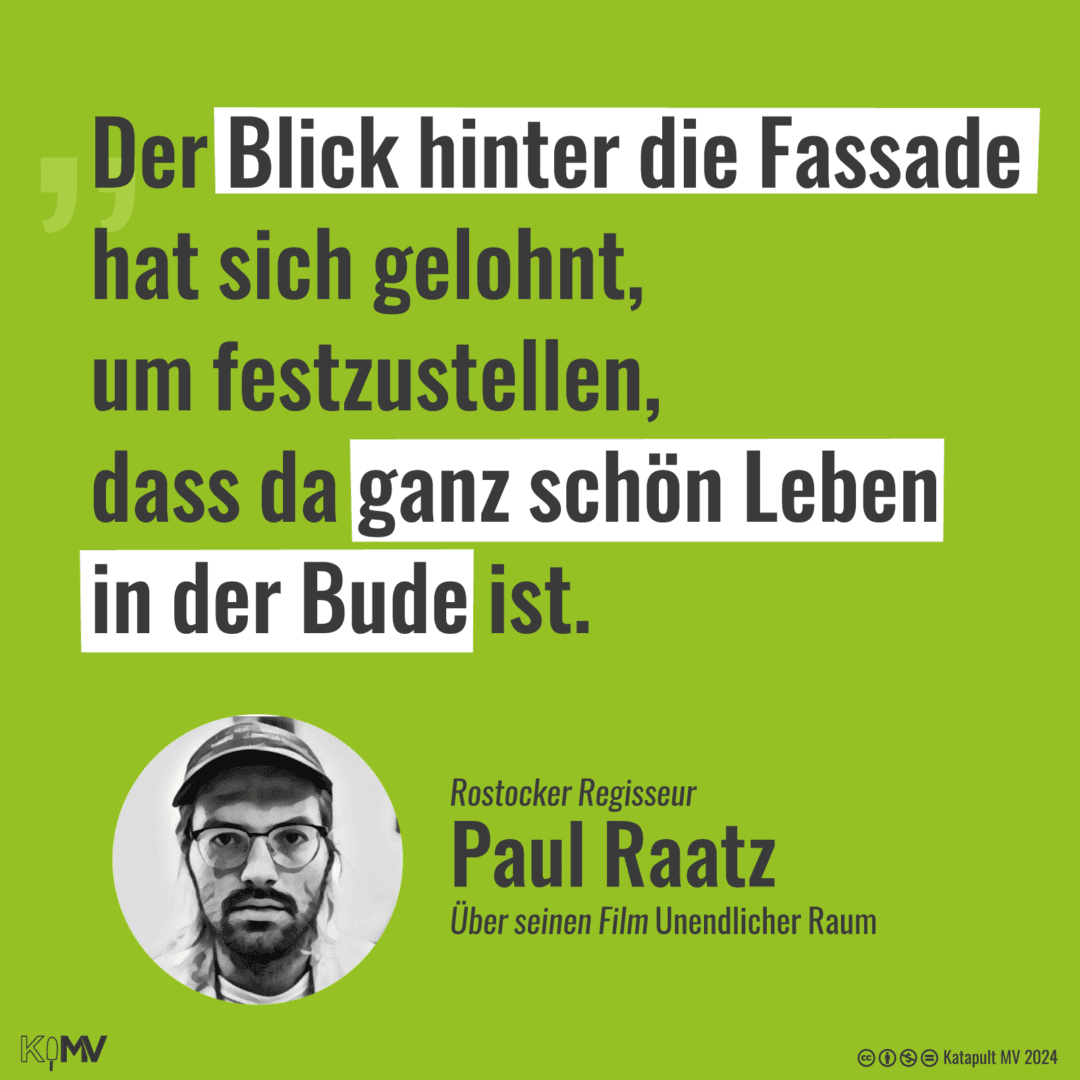KATAPULT MV: Du kommst ursprünglich aus Stralsund. Was ist deine erste Erinnerung an Loitz, unabhängig von dem Film?
Paul Raatz: Tatsächlich wusste ich immer nur, dass der Ort [løːts] ausgesprochen wird und nicht [lɔɪ̯t͡s]. Verbindungen zum ländlichen Raum hatte ich ansonsten nur durch Klassenkamerad:innen oder Partnerinnen. So bin ich manchmal raus aus der Stadt gekommen.
Dabei hat sich für mich ein nicht unbedingt falsches, aber zumindest sehr einseitiges Bild ergeben. Zum Beispiel, dass es im ländlichen Raum viel Rechtsradikalismus gibt. Dieses Vorurteil hat mich dann eigentlich seit meiner Schulzeit bis zum Dreh in Loitz begleitet.
Wie seid ihr überhaupt auf Loitz aufmerksam geworden?
2021 wurden wir angefragt, ob wir für ein Leuchtturmprojekt in Loitz eine Art Werbevideo machen können. Mit dem Projekt wollte man Großstädter:innen die Chance geben, für ein Jahr im ländlichen Raum zu leben. Mit Haus und Grundeinkommen. So hab ich die Stadt dann kennengelernt und war am Anfang sogar ein bisschen erschrocken. Die Idee für einen Dokumentarfilm entstand schon in Vorgesprächen für das Werbevideo.
Wie hättest du Loitz damals mit einem Wort beschrieben?
Ich weiß nicht, ob trostlos das richtige Wort ist, aber ich hätte wohl kaputt gesagt. Als wir zum ersten Mal die Hauptstraße entlanggefahren sind, zeigte sich ein trauriges Bild. Man konnte erahnen, dass hier mal richtig Leben war. Und auf den ersten Blick ist davon nur sehr wenig übrig. Wenn man mal Leute auf der Straße gesehen hat, waren die auch meistens über 60. Dafür, dass Loitz ja eigentlich eine Stadt ist, wirkte alles wenig städtisch.

Und wie habt ihr euch dann an Ort und Leute herangetastet?
Wir haben uns mit den Menschen unterhalten. Zum Beispiel mit den Betreibern des ältesten Ladens oder mit einer Frisörin. Die haben dann von anderen Leuten erzählt, mit denen wir uns dann trafen. Parallel haben wir schon damit begonnen, Testaufnahmen zu machen. Wir haben dann schnell gemerkt, dass es in Loitz ganz viele spannende Leute gibt. Manche sind dort geboren und waren nie weg. Manche waren mal fort und sind zurückgekommen.
Ihr habt quasi einfach an Türen geklopft und von den Filmplänen erzählt?
Ja, genau. Ein paar Leute hat das aber auch verunsichert und wir sind nicht mit allen zusammengekommen. Aber daraus haben sich immer neue Kontakte zu Menschen ergeben, die dem offen gegenüberstanden.
Wie zum Beispiel Annika und Rolando, die über das Leuchtturmprojekt von Berlin nach Loitz gekommen sind?
Genau. So starten wir in den Film. Gemeinsam mit den beiden Neuankömmlingen kommen auch wir im Ort an. Mit der Zeit entfaltet sich Loitz aber immer mehr. „Wie eine Blume“, hat mein Freund und Filmkollege Max Gleschinski gesagt. Der Film verlässt Annika und Rolando aber auch irgendwann und findet woanders statt.
Um welche Menschen geht es außerdem?
Zum einen um eine Festivalcrew, die auf dem Gelände der ehemaligen Stärkefabrik ein Festival organisieren will. Niemand davon lebt in Loitz, ein paar kommen aber ursprünglich aus der Gegend.
Es geht außerdem um den Künstler Peter Tucholski und seinen Kulturhotspot Ballsaal. Wir begleiten den Loitzer Schlagersänger René Ronell und einen gebürtigen Loitzer, der mit seiner Familie zurück zieht. Zwischendurch geht es auch mal um die Bürgermeisterin und weitere Loitzer Gesichter.Wir haben uns immer ganz polemisch gesagt: Loitz ist eine sterbende Stadt. Und irgendwie stimmt das auch. Sie wird aber von ihren Einwohner:innen am Leben gehalten. Aufgrund ihres Drangs zur Selbstverwirklichung sorgen sie dafür, dass Loitz weiterlebt und dort was passiert. Dabei entstehen auch mal Reibungen und Meinungsverschiedenheiten mit anderen. Aber das zeigt ja auch, dass ein Prozess stattfindet.

Leben auch junge Leute in Loitz?
Anfangs hatten wir überhaupt keinen Kontakt zu Jugendlichen. Manchmal haben wir kleine Gruppen gesehen, wussten aber nicht, ob sie überhaupt hier wohnen. Das hat sich erst geändert, als wir bei Schlagersänger René zu Gast waren. Seine älteste Tochter haben wir gefragt, was sie eigentlich außerhalb ihrer Ausbildung macht und ob es hier andere Jugendliche gibt. Sie meinte: „Ja klar, wir haben einen Garten. Da hängen wir immer ab.“ Kameramann Jean-Pierre und ich haben die Gruppe dann in der Weihnachtszeit kennengelernt und mit ihnen Glühwein getrunken.Später hat sich dann organisch ergeben, dass wir sie auch mit der Kamera begleiten konnten. Das war wie in einer Parallelwelt, weil sich die Jugendlichen selbst organisieren und ihren Ort, den Treffpunkt im Garten, selbst geschaffen haben. Wenn ich mich richtig erinnere, war das nicht mal der einzige Garten. Es gibt verschiedene Cliquen, die sich abseits der öffentlichen Wahrnehmung ihre eigene Jugendkultur geschaffen haben. Das finde ich total schön.

Wie viel Prozent des Films macht Beziehungsarbeit und wie viel Filmarbeit aus?
Das verändert sich im Prozess. Am Anfang waren es vielleicht 80 Prozent Beziehungsarbeit und 20 Prozent Drehen. Weil man sich über die Zeit aber immer besser kennenlernt, nimmt die Filmarbeit dann zu.Was uns in Loitz aber überrascht hat, war, dass wir auf der Straße wiedererkannt wurden. Es hat kein halbes Jahr gedauert, bis uns die Leute auf der Straße gegrüßt haben oder uns einen Kaffee anbieten wollten. Wir haben dann gemerkt, dass die Leute richtig Bock auf das Projekt bekommen, wenn Vertrauen aufgebaut wird. Dass viele Leute ein tolles Mitteilungsbedürfnis haben und auch gern über Loitz und ihr Leben dort sprechen. Das war richtig toll und einer der Hauptgründe, warum wir einen Dokumentarfilm fürs Kino machen wollten. Wir wollen Vorpommern eine Stimme geben.
Wie viel Kohle braucht man eigentlich für so einen Film und wo kam die her?
Das Gesamtbudget lag bei etwa 120.000 Euro – was ein riesiger Batzen Geld ist. Aber es haben auch mehrere Leute drei Jahre lang daran gearbeitet. Ein Großteil konnten wir über die MV-Filmförderung realisieren. Außerdem haben die NDR-Kulturförderung, die Rosa-Luxemburg-Stiftung und die Sparkasse Vorpommern unterstützt. Wir haben aber ziemlich naiv kalkuliert und dachten, dass 20 Drehtage ausreichen. Letztendlich wurden es um die 50 Drehtage, dazu kamen noch Schnitt, Ton- und Farbgestaltung.
Lässt sich ein Dokumentarfilm überhaupt planen?
Das war ein großes Problem, besonders bei Finanzierungsanträgen. Man musste nämlich beschreiben, was in dem Film passieren könnte, ohne dass man weiß, was eigentlich passieren wird. 90 Prozent von dem, was ich damals aufgeschrieben habe, hat sich ganz anders entwickelt.
Ist die Unplanbarkeit reizvoll für dich oder denkst du eher: nie wieder?
Das ist tagesformabhängig. Manchmal freue ich mich über klare Drehbücher, weil ich weiß, was passieren wird. Aber das Abtauchen in neue Lebensrealitäten ist schon extrem spannend. Ich würde es auf keinen Fall ausschließen, noch mal einen Dokumentarfilm zu machen.
Du hattest am Anfang von Vorurteilen gesprochen. Welche davon haben sich erhärtet, welche aufgelöst?
Es ist natürlich auffällig, dass einem immer mal rechte Sprüche begegnen. Aber im Großen und Ganzen war es das erst mal. In den drei Jahren, in denen wir regelmäßig in Loitz waren, ist uns, bis auf einen Bürgerdialog im Januar 2023, nichts weiter Problematisches aufgefallen.Ich weiß nicht, ob wir mit den Leuten zu wenig über Politik gesprochen haben, aber ich hatte immer das Gefühl, dass dort eine gewisse Weltoffenheit herrscht. Das hat mich irgendwie überrascht.
Ich war damals selbst für einen Videobeitrag auf dem Bürgerdialog und war total erschrocken von der Stimmung.
Ja, das war ganz schön übel. Das war auch der Punkt, an dem wir politischer über den Film nachgedacht haben. Als wir damals mit dem Film begonnen haben, habe ich mich nämlich über mich selbst und meine Vorurteile geärgert. Ich dachte sofort, dass es auch um Rechtsradikalismus gehen muss, wenn man Geschichten aus Vorpommern erzählt. Doch wenn es eins gibt, das der Rest von Deutschland mit MV oder Ostdeutschland verbindet, dann Rechtsradikalismus. Daher wollte ich das Thema eigentlich nicht groß behandeln, wenn ich nichts Neues beizutragen habe. Da gibt es etliche Dokus, die das bereits viel besser behandeln. Aber irgendwie konnten wir es trotzdem im Film unterbringen.
Hat dich Loitz politisiert?
Hm. Mir hat es geholfen, mich selbst zu reflektieren. Das Bild, das ich vom ländlichen Raum hatte, konnte ich dadurch in ein besseres, ambivalenteres Licht rücken. Es war schön, zu merken, dass ich mit diesem Film etwas lernen konnte.
Was können wir von Loitz lernen?
Dass es sich lohnt, die eigene Neugier zu bewahren, offen zu sein und in den Austausch zu gehen. Ich hatte immer das Gefühl, dass es dort eine sehr offene Debattenkultur gibt.
Es gibt also viel Platz für Meinungen und Möglichkeiten. Deswegen vielleicht auch der Titel Unendlicher Raum?
(lacht) Ja, da steckt eigentlich alles drin. Wir haben uns für den Namen entschieden, weil es so viel Leerstand gab, weil bei der Ausarbeitung von Konzepten oft von Raumpionieren gesprochen wurde. Das hat den Ort als kleines Abenteuer erscheinen lassen. Der Titel vereint all das für uns, was dem Raum eine Bedeutung gibt.
Wie würdest du Loitz jetzt mit einem Wort beschreiben, nachdem du den Menschen dort so nahe gekommen bist?
Lebendig. Ich konnte bei mir einen richtigen Haltungswechsel feststellen. Während ich am Anfang des Projektes schon manchmal dachte, „Wann fahren wir wieder?“, hatte ich im Verlauf immer größere Lust, in Loitz zu sein. Der Blick hinter die Fassade hat sich gelohnt, um festzustellen, dass da ganz schön Leben in der Bude ist.