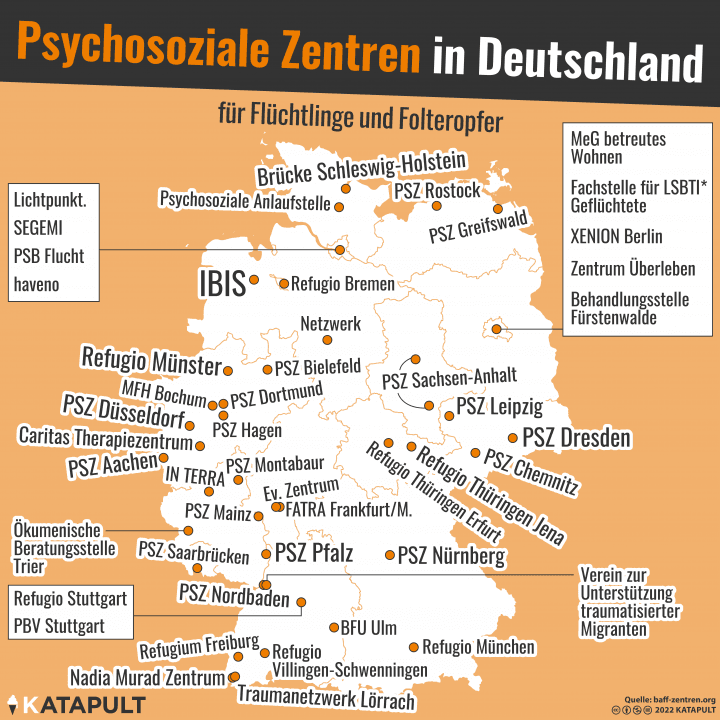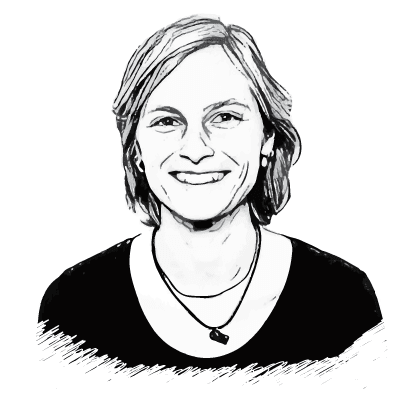Die ersten Gespräche mit Geflüchteten aus der Ukraine hatte Florian Harder vom Psychosozialen Zentrum (PSZ) Vorpommern vor zwei Wochen in Altentreptow. Dort wurden etwa 30 Menschen vorübergehend in einer Notunterkunft versorgt. Ihr Gemütszustand war sehr individuell, beschreibt er. Natürlich waren alle entsetzt, dass Putin wirklich ihr Heimatland angegriffen hatte. Auch sorgen sich alle um ihre Familienmitglieder, die noch vor Ort sind. Diese Belastung würden aber relativ viele für sich austragen, so Harder. Für die meisten sei es (noch) zu schwer, sich eine Art Auszeit von den existenziellen Gedanken zu nehmen, um selbst in den Heimen anzukommen.
In noch größeren Notunterkünften, wie etwa der Hansemesse in Rostock, komme hinzu, dass es dort gar nicht die Ruhe und Privatsphäre gebe, in der Geflüchtete sich überhaupt bewusst werden könnten, dass sie psychologische Hilfe brauchen, sagt Ulrike Wanitschke vom dortigen PSZ. Gerade Traumata seien bei geflüchteten Menschen ein großes Problem. „Und die Gemeinschaftsunterkünfte tragen nicht gerade dazu bei, dass sich die psychische Situation verbessert“, sagt Franziska Rebentisch, Ärztin am PSZ.
Gruppentherapien statt Einzelgespräche
Auch die Organisation „Rostock hilft“ fürchtet Retraumatisierungen in den Notunterkünften: „Gerade Flüchtende, die direkt aus einem Kriegsgebiet kommen, brauchen Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten. In einer Halle mit 500 aneinandergereihten Betten ist es jedoch immer laut, immer hell und psychisch extrem belastend“, sagt Sprecherin Christin Voss.
Es werden zukünftig noch viele Helfende gebraucht, heißt es von beiden Zentren. Denn die großen Aufgaben zur Traumabewältigung kommen erst noch. „Wir rechnen mit einem steigenden Mehrbedarf durch den Krieg“, sagt Rebentisch.
Um die vielen ankommenden Menschen bei Bedarf schnellstmöglich psychologisch zu versorgen, setzen die Zentren erst einmal auf Gesprächsrunden in Gruppen – dazu gehen sie auch in die Unterkünfte, bieten aber auch digitale Alternativen an. So können zum einen viele der Neuankömmlinge betreut werden, zum anderen würden die Menschen sehen, dass andere ihre Ängste teilen. Auch das könne schon mal helfen, sagt Wanitschke.
Angebote der Zentren kaum bekannt
Einzelgespräche werden aber ebenfalls nötig sein. „Da werden auch ein oder zwei Gespräche nicht reichen“, befürchtet Harder. Und er weist darauf hin, dass ukrainische Geflüchtete derzeit nicht die einzigen sind, die psychosoziale Hilfe brauchen. Schon vor dem Angriffskrieg waren die Notunterkünfte voll. Auf der Warteliste des Rostocker Zentrums standen da schon 20 Namen. Dabei wissen viele gar nicht um diese Möglichkeit zur psychologischen Hilfe.
Beide psychosozialen Zentren betonen, dass ihre Angebote kaum bekannt seien. Von alleine komme niemand, der Hilfe nötig hat. „Das geht alles über Betreuende oder die Koordinationsteams in den Unterkünften“, sagt Wanitschke. Was aber jetzt aktuell nötig sei, sind Supervisionen von freiwilligen Helfer:innen. Zum Teil arbeiten sie in Zwölf-Stunden-Schichten in den Unterkünften und betreuen die ankommenden Geflüchteten. „Eigentlich wäre es angebracht, professionelle Leute dort zu aktivieren“ – das aber sei eine Geldfrage.
Auch Ehrenamtliche brauchen psychische Hilfe
Daher müssten zumindest die Ehrenamtlichen geschult werden, da die Situation auch für sie laut Wanitschke eine hohe emotionale Belastung ist. Es gebe viele Helfer:innen, die ausbrennen und daher psychische Betreuung brauchen. „Übersetzen ist psychisch der schwerste Job“, sagt Christin Voss, Sprecherin von „Rostock hilft“.
Das PSZ in Rostock ist noch recht jung. 2020 wurde es offiziell gegründet, vergangenen Sommer bezog das Team seine Räume in der Paulstraße. Dort arbeiten vorwiegend ehrenamtliche Ärztinnen, Sozialarbeiter, Psychotherapeuten, Dolmetscherinnen, Kunsttherapeutinnen sowie eine hauptamtliche Koordinatorin in Teilzeit. Das Zentrum müsse erst einmal bekannter werden, das Team müsse weiter wachsen und die aktuelle Aufmerksamkeit genutzt werden, um Stadt und Land um finanzielle Unterstützung zu bitten, sagt Ulrike Wanitschke.
Keine staatliche Finanzierung
Das Zentrum finanziert sich durch Fonds und Spenden. „Unsere ärztlichen Honorare spenden wir zurück“, sagt Franziska Rebentisch. Von der Stadt Rostock gebe es keine finanzielle Unterstützung. „Die finden unsere Arbeit ganz toll, führen uns als Best-Practice-Beispiel an. Aber Geld gibt es nicht.“ Zwar sei die private Spendenbereitschaft enorm, doch ein fester Betrag von staatlicher Seite, mit dem regelmäßig gerechnet werden kann, sei notwendig. „Jetzt gerade sieht man es wieder: Es gibt einen hohen Bedarf an medizinischer Versorgung durch Krieg und Geflüchtete. Und dafür braucht es Geld.“
Während bundesweit einige psychosozialen Zentren mit bis zu 14 Prozent kommunal gefördert werden, sind es in Rostock 0 Prozent. Und Förderanträge zu schreiben, koste auch Zeit. Dabei sollte doch die Klientenarbeit oberste Priorität haben.
Finanzierung mit Lücken
Das PSZ Vorpommern gibt es seit mehr als 30 Jahren. Finanziert wird es ebenfalls über befristete Fördergelder, etwa aus dem europäischen Fonds für Asyl, Migration und Integration, von Amnesty International, der Diakonie und aus Landesmitteln. Mitte dieses Jahres läuft diese Finanzierung aus. Eine Anschlussfinanzierung sei noch nicht gesichert und müsse so oder so für etwa ein halbes Jahr überbrückt werden, erzählt Florian Harder.
Mit ehrenamtlicher Unterstützung könne man das auch irgendwie schaffen. Aber nach den Erfahrungen der Migrationen 2014 werde auch diese nach und nach abebben. Dann sollte, so der Wunsch beider Zentren in MV, ihre Finanzierung auf festen Füßen stehen.